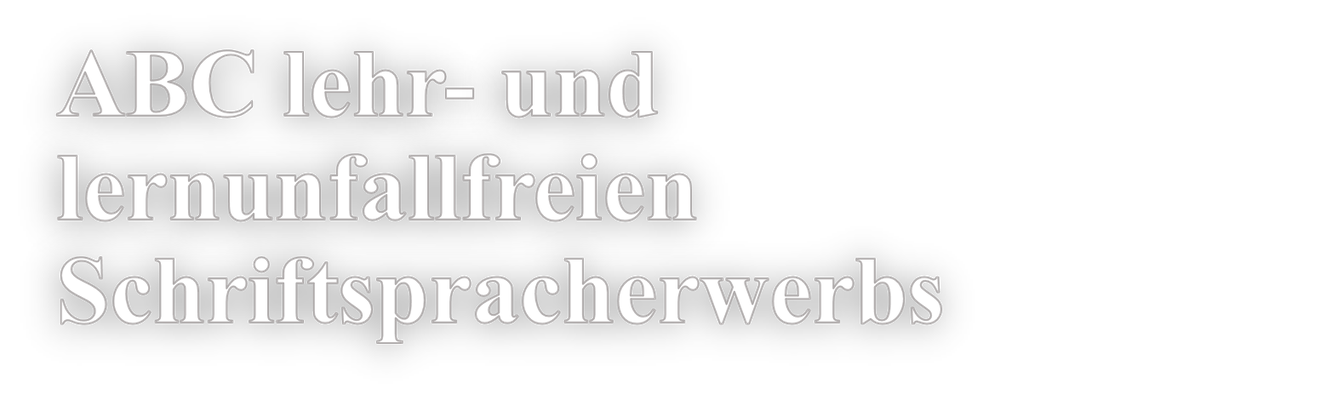Prof .Dr .Dr . h.c .Gustav KANTER/Köln in:
Peter (Hrsg. ): Schreiben und Lesen sicher lehren und lernen
Voraussetzungen, Risikofaktoren ,Hilfen bei Schwierigkeiten. Dortmund: borgmann 2000 ,528 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen ,..... .
Der „verlag modernes Lernen"„borgmann publishing" wird in zahlreichen Titeln immer wieder der selbst gesetzten Zielsetzung gerecht, interessierten Lesern wie auch Fachleuten moderne Lehr -und Lernverfahren praxisnah und verständlich vorzustellen. Dabei werden insbesondere auch Bücher und Schriften zur Aufklärung und Überwindung von Entwicklungs -und Lernschwierigkeiten aufgelegt . Der vorliegende Sammelband von Peter Haase ist ein weiterer überzeugender Beleg für dieses erfolgreiche Verlagsprogramm .
Zusammen mit anerkannten Fachleuten greift Haase, ein engagierter Pädagoge mit langjähriger Unterrichtspraxis sowie naturwissenschaftlich ausgerichtete r Erfahrung in der pädagogisch-psychologischen Feldforschung ,fast möchte man sagen wiederum und zum xten Male, das unendliche Thema der Lese -und Schreibförderung auf und stellt in seinem Buch sowohl mehr oder weniger bekannte Weiterentwicklungen der einschlägigen Forschung als auch eigene neue Forschungsergebnisse vor .
Mit dieser Kurzcharakteristik des Bandes könnte man eigentlich zur Tagesordnung übergehen; denn neue Publikationen zu dieser Thematik füllen international jährlich Regalmeter. Zumindest im Blick auf deutsche Verhältnisse sollte man mit dem vorliegenden Buch jedoch so nicht verfahren. Dem Herausgeber ist es nämlich gelungen, Beiträge zusammenzustellen, die schwerpunktmäßig einem hierzulande etwas vernachlässigten Themenkreis zuzuordnen sind, der sich im weiteren Sinne als Biologie des Lernens (hier speziell des Sprach/Schriftspracherwerbs) umschreiben lässt und viel zu wenig Beachtung findet. Hierzu handeln die Autoren verschiedene hochbedeutsame Problemaspekte des Schriftspracherwerbs sachkundig ab, die in engeren, Fachkreisen-zu- Teilen-zwar-, grundsätzlich-bekannt-sind, in der pädagogischen Praxis aber wie auch in übergreifenden Theoriebildungen bislang wenig bedacht werden.
Die hier vorgestellten Sachbeiträge sind wohl alle irgendwie pädagogisch gewichtet, doch geht das Erkenntnisinteresse einer Mehrzahl
der dreißig beteiligten Autoren deutlich über den engeren Rahmen der Fachdisziplin hinaus und ist zum einen auf den Bereich der Sinnes- und informationsbedingten Störfaktoren von Lernprozessen, zum anderen auf seelische und umweltbedingte Einwirkungen gerichtet. In diesem Zusammenhang wird auch ein originäres interdisziplinäres Forschungsprojekt zu sinnesbedingten Beeinträchtigungen des Schriftspracherwerbs vorgestellt. Ein Glossar sowie nützliche Anschriften von Fachorganisationen und Selbsthilfegruppen runden den Band ab. In ihren Beiträgen sind die Autoren ausdrücklich bemüht, die jeweils praxisrelevanten Folgen der Forschungserkenntnisse aufzuzeigen, und versäumen nicht, auch konkrete Hinweise für ein zweckmäßiges Erziehungshandeln sowie für die therapeutische Praxis zu geben.
Das Buch soll, wie der Herausgeber schreibt, „Grund- und Sonderschullehrkräfte in die Lage versetzen, auch Kinder mit Risikofaktoren für den Schriftspracherwerb erfolgreich zu unterrichten und Legasthenietherapie auf eine seriöse Grundlage zu stellen". Schließlich soll es auch „Eltern Hilfe geben, die für Problemkinder auf Hilfe angewiesen sind".
Im einzelnen ist der Sammelband nach folgenden Themengruppen geordnet: Voraussetzungen für das Schreiben- und Lesenlernen - Gesellschaftspolitische Gründe für eine Veränderung des Anfangsunterrichts - Erbliche und andere Risikofaktoren des Schriftspracherwerbs - Wege, Kinder trotz ihrer Handicaps zum Lernerfolg zu führen - Übungsformen und Kompensationshilfen - Kinder davor bewahren, beim Lesenlernen auf einen Holzweg zu geraten.
So geht etwa im Rahmen der ersten Themengruppe der bekannte Legastheniespezialist Helmut Breuer (Greifswald) aus pädagogisch-psychologischer Sicht auf Fragen der Früherkennung und Frühförderung ein, parallel dazu der Kinder- und Jugendpsychiater Schulte-Körne (Marburg) auf neueste Befunde zu neurobiologischen Korrelaten der Lautbewusstheit und Sprachwahrnehmung.
Praktische Fragen der schulärztlichen Eingangsuntersuchung (Haacke, Melsungen) werden ebenso angesprochen wie Befunde aus der forensischen Psychiatrie über psychisch kranke Rechtsbrecher mit Teilleistungsschwächen (Tyka, Nörten-Hardenberg). In der forensischen Klinik des Referenten fanden sich unter den Patienten immerhin 10-15% funktionale Analphabeten. Maria Weuffen (Greifswald) wie auch der schon o. g. Mediziner Schule-Körne gehen des Weiteren auf Fragen genetischer, sozialer und biologischer Risikofaktoren ein. Verschiedene Beiträge sind der oben erwähnten interdisziplinären Pilotstudie des Herausgebers gewidmet, in der definierten auditiven und visuellen Störfaktoren nachgegangen wird, einer Verursachungruppe, deren Bedeutung für den Schriftspracherwerb auch von Fachleuten oft unterschätzt wird. Beteiligt waren hier u. a. das Institut für Medizinische Psychologie der Universität München (von Steinbüchel/Wittmann/Landauer), die Universitäts-Augenklinik Göttingen (Mühlendyck) sowie die Sehschule der Universitäts-Augenklinik Würzburg (Schäfer). In die gleiche Richtung zielt der Bericht von Wurm-Dinse und G. Esser (Audiologisches Zentrum Düsseldorf-Gerresheim). Verschiedene Sprachverständigungsstörungen geben einen weiteren Verursachungsbereich ab, auf den Amorosa (Heckscher Klinik, München) eingeht.Für Fachleute von hohem Interesse dürfte sein, dass nach dem Bericht von Yamada (Hiroshima) auch im Japanischen strukturell gleiche Störfaktoren beim Lesen- und Schreibenlernen anzutreffen sind wie im westeuropäischen Sprachgebiet.
Die Abhandlungen zur Vorbeugung, Verhinderung und Überwindung von Lese- und Schreibschwierigkeiten stoßen sicher auf das beson-
dere Interesse der Praktiker. Einige wenige Beiträge seien hier genannt:
- Gösy/Budapest (Wege zut Vermeidung...),
- Breuninger/Stuttgart (Teufelskreis Lernstörungen),
- Schilling/Marburg (Motorik),
- Haase/Melsungen (Handzeichen),
- Dummer-Smoch/Bordesholm (Lese-Intensivmaßnahmen oder LRS-Klassen ).
Auf weitere Einzelbeiträge näher einzugehen, wurde den Rahmen dieser Kurzbesprechung sprengen. Die Artikel sind je nach Standort der Autoren und Zugriff auf die Thematik unterschiedlich. Dies gilt inhaltlich wie auch bezüglich der methodischen Elaboriertheit. Neben mehr wissenschaftlich gewichteten Abhandlungen finden sich in einem derartigen Sammelband verständlicherweise auch Ansichtsbekundungen. Insgesamt jedoch sind die Beiträge sehr informativ und Horizont-weitend. Sie helfen denjenigen, die in der Praxis mit Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs konfrontiert werden, konkrete Diagnose-und Förderwege besser abschätzen zu können, schärfen den Blick für mögliche (nicht selten verdeckte) Störfaktoren und machen Fachleute auf wenig erschlossene Forschungsbereiche sowie Erkenntnisquellen aufmerksam. Nicht zuletzt trägt der Band dazu bei, das Arbeitsprofil einer wohl verstandenen neueren Sonderpädagogik/Förderpädagogik zu verdeutlichen. Hlier geht es nicht (wie häufig kolportiert) darum, die Allgemeine Schule von leistungsschwachen und störenden Schülern zu „entlasten" und die Kinder in eigenen Klassen auf „niedrigerem Anspruchsniveau" zu unterrichten. Vielmehr sind pädagogische und pädagogisch-therapeutische Fachkolleginnen und Fachkollegen mit Experten wissen bemüht, Störfaktoren in erschwerten Lern- und Entwicklungssituationen aufzuspüren und auf dieser Informationsbasis individuelle Förderhilfen und -Strategien zu entwerfen.
Gleichwohl haben Fördermaßnahmen in dieser Konzeption nicht den Stellenwert von isolierten Funktionstrainings, sondern werden als Teil einer ganzheitlichen, lebensweltorientierten pädagogischen Intervention gesehen. Es versteht sich von selbst, dass derartige Hilfe nicht an einen bestimmten Ort gebunden sein muss,sondern ganz nach individuellem Bedarf und situativen Gegebenheiten in Allgemeinen Schulen, in Sonderschulen, in Fördergruppen, in der Einzelfallhilfe wie auch im alltäglichen familiären Erziehungsumgang erfolgen kann.
Dem Leser der verschiedenen Kapitel dieses Buches wird wieder einmal mehr die Vielfalt möglicher Störfaktoren in Lern- und Entwicklungsprozessen vor Augen gestellt und die Notwendigkeit verdeutlicht, sensibel und mit pädagisch-psychologischem wie auch medizinischem Sachverstand bei der Abklärung von Schwierigkeiten vorzugehen. Ein positives Ergebnis solchen Forschens und Denkens ist die Gewissheit, dass Hilfe in den meisten Fällen nicht nur möglich, sondern auch höchst wirksam ist.
Abschließende Empfehlung: Der Sammelband mit seinen verschieden zu gewichtenden Beiträgen stellt keine erschöpfende und in sich geschlossene Abhandlung zur Thematik dar, noch weniger allerdings ist er als „Kochbuch" für eine bestimmte Form der Lese- und Schreibhilfe gedacht. Vielmehr handelt es sich um eine Vielfalt von Denkanstößen und Aufklärungshilfen, die dem Leser dazu dienen sollen, Lern- und Entwicklungsprobleme differenzierter wahrzunehmen und erzieherisches sowie therapeutisches Handeln zu optimieren.
So gesehen ist es auch nicht notwendig, das Buch in einem Zug von vorn bis zum Ende durchzuarbeiten, sondern es können auch ausgewählte Kapitel mit Gewinn gelesen und bedacht werden. Insofern ist es aufgeschlossenen Lesern jeglicher Profession und Interessenlage bestens empfehlen und kann sicher auch Arbeitsgrundlage für einschlägige Seminare und Diskussionsgruppen sein. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, wird um weiterführende Fachliteratur
freilich nicht herumkommen.
Gustav Kanter
aps BUNDESSEKTION PFLICHTSCHULLEHRER IN DER GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST 11 /2000.November/Dezember
Seit es Schule gibt, hat sie auch die ureigentliche Aufgabe, die Kinder in die Kulturtechniken des Lesens und Schreibens einzuführen und ihnen diese möglichst kindgerecht zu vermitteln. Vor einigen Jahren hat in Kalifornien ein achtzehnjähriger Schüler der Highschool den Staat auf Schadenersatz verklagt und den Prozess auch gewonnen, weil er nach beinahe zwölfjähriger Schulzeit immer noch Analphabet war bzw. nicht lesen und schreiben konnte. Und es ist tatsächlich leider nicht selbstverständlich und in jedem Fall sicher gestellt, dass trotz ausgefeiltester Methodik und bei allen Bemühungen um eine positive Lernumwelt und um kindgemäßes sowie intensives Lernen und Üben sich der Erfolg dann auch tatsächlich ein stellt.
Zahlreiche in den vergangenen Jahren gewonnene Kenntnisse über neuropsychologische Grundlagen von Lernprozessen, insbesondere bei der Aufnahme und Verarbeitung von Sprache und Schrift, sind diesbezüglich von größter Relevanz und verweisen z. B. eindringlich auf die Bedeutung der Lautbewusstheit und deren neurobiologische Korrelate für das Lesen- und Schreibenlernen, da die Schriftsprache auf der Lautsprache aufbaut.
Aus dem Inhalt:
Die 28 Beiträge von renommierten Fachleuten und Praktikern tragen dem Rechnung und sind um 6 Hauptthemen gruppiert:
- Voraussetzungen für das Schreiben- und Lesenlernen
- Gesellschaftliche Gründe für eine Veränderung des Anfangsunterrichts
- Erbliche und andere Risikofaktoren des Schriftsprachenerwerbs
- Wege, Kinder trotz ihrer Handicaps zum Lernerfolg zu führen
- Übungsformen für alle und Kompensationshilfen für legasthenische Kinder
- Kinder davor bewahren, beim Lesenlernen auf einen Holzweg zu geraten
Der Herausgeber des Buches ist Gründer und Leiter des Deutschen Instituts für neuropsychologisch orientierte Didaktik des Anfangsunterrichts der Kulturtechniken und war neben seiner wissenschaftlichen Arbeit mehr als dreißig Jahren lang als Sonderschullehrer tätig. In diesem Werk kommen Mediziner, Psychologen, Therapeuten und Pädagogen bzw. Lehrerinnen zu Wort - wobei die Situation von lese- und rechtschreibschwachen Schülerinnen nachhaltig bedacht wird - und stellen in ihren Beiträgen u. a. dar, welche sinnes- und sinnesinformationsbedingten sowie seelischen Störfaktoren Lernprozesse erschweren oder gar verhindern, wenn sie nicht erkannt werden; wie solche Störfaktoren zum Teil schon vor der Einschulung erkannt und angegangen werden können; wie bereits zu Beginn der Grundschulzeit Hinweise auf kritische Lernentwicklungen gewonnen werden können und was dann prä
ventiv und therapeutisch getan werden kann; welche Möglichkeiten für Eltern und Lehrerinnen bestehen, Kindern beim Überwinden von Schwierigkeiten zu helfen; welche Unterstützungen und Hilfen eingeholt werden können, da mit ein Kind in den beiden ersten Grundschuljahren möglichst erfolgreich das Lesen und Schreiben lernt; was unumgänglich ist, damit ein in seinem ersten und zweiten Schulbesuchsjahr wenig oder nicht erfolgreiches Kind zügig aufholen kann.
wie Kinder mit Lernschwierigkeiten vor dem Abgleiten in psychosoziale Teufelskreise aufgefangen und bewahrt werden können; wie moderne Medien (z. B. Computerprogramme, technische Hilfen) auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft bzw. geprüft werden können.
Mit Beiträgen von:
M. Aguilar,
G. Alliger,
H. Amorosa,
H. Brenn,
H. Breuer,
H. Breuninger,
M. Corlazzi,
L. Dummer- Smoch,
G. Esser,
M. Gösy,
J. Graichen,
J. N. Guzman,
U. Haacke,
P. Haase,
R. Hackethal,
M. Hunter-Carsch,
N. Landauer,
H. Mühlendyck,
E. Otto,
C. Reuter-Liehr,
W. D. Schäfer,
F. Schilling,
G. Schulte-Körne,
N. von Steinbüchel,
A. Tyka,
U. Veitmann,
M. Weuffen,
M. Wittmann,
U. Wurm-Dinse,
J. Yamada.
Ein Glossar und eine Übersicht über einschlägige Selbsthilfegruppen und Organisationen runden die kompetenten Fachbeiträge ab. Gewissermaßen „nebenbei" wird immer wieder zu aktuellen Fragen Stellung genommen. So wird z. B. die Forderung erhoben, auf Lehrstühle für Grundschulpädagogik nur Professorinnen zu berufen, die wenigstens 8 Jahre (!) Vollzeit-Grundschulunterricht erfolgreich geleistet haben*) (S. 309) - eine Aussage, die angesichts der Neuordnung der Pflichtschullehrerausbildung in Österreich infolge der Weiterentwicklung Pädagogischen Akademien gemäß Akademien-Studiengesetz 1999 und die dadurch bedingte Neuregelung der entsprechenden Anstellungsbedingungen nach Anlage 1 BOG bzw. der universitären Pflichtschullehrerausbildung in der BRD sofort in die Augen sticht.
HTTP .-//WWW.SCHULRATGEBER.
Schreiben und Lesen sicher lehren und lernen - Voraussetzungen, Risikofaktoren, Hilfen bei Schwierigkeiten Peter Haase (Hrsgb) 528 Seiten Borgmann Publishing GmbH; ISBN: 3-86145-186-7
Rezension des Buches durch den Schulratgeber:
Dieses Buch stellt aus multiprofessioneller Sicht (Wissenschaftler, Mediziner, Therapeuten und Pädagogen) dar, welche sinnes- und sinnesinformationsbedingten und seelischen Störfaktoren Lernprozesse erschweren oder gar verhindern, wenn sie nicht erkannt werden. Dabei liefert es hilfreiche Information bei der vorschulischen Diagnostik und Behandlung. Auch sensibilisiert es den Blick für Hinweise auf eine kritische Lernentwicklung in den ersten Grundschulwochen und zeigt Wege auf, diesen entgegen zu wirken.
„Schreiben und Lesen sicher lehren und lernen: Voraussetzungen, Risikofaktoren, Hilfen bei Schwierigkeiten" Peter Haase und seine Ko-Autorinnen und -Autoren weisen in eindrucksvollen und verständlich formulierten Artikeln nach, welche Lernvoraussetzungen ein Kind erfüllen muss, um im Schreib/Lese-Anfangsunterricht erfolgreich mitzuarbeiten. Mögliche Störungen werden aus neuropsychologischer und pädagogischer Sicht aufgezeigt und sinnvolle Interventionen darauf diskutiert. Formen der Früherkennung und der präventiven Therapie im Vorschulalter werden vorgestellt.
Didaktische und methodische Grundsätze des Erstlese- und Schreibunterrichts werden dem Leser in vorbildlicher Form nahe gebracht. Das
Buch überzeugt durch seine hervorragende wissenschaftliche Qualität, seinen durch keinerlei Dogmen getrübten Blick und seine fundierte Praxisnähe.
Im Bereich der Diagnostik verhilft dieses Buch zu einer gesamtheitlichen Sichtweise des Phänomens Lese- und Rechtschreibschwäche; und bietet somit Möglichkeiten, gezielte Förderprogramme zu entwickeln oder sonstige, z.B. medizinische Unterstützung, beizuziehen. Auch fehlt nicht der Ausblick auf die sozialen Konsequenzen einer nicht erkannten und behandelten Lese-Rechtschreib-Schwäche. Insgesamt erreicht dieses Buch durch die Vielzahl von qualifizierten Beitrügen eine Informationsdichte und -tiefe, die es dem interessierten Leser ermöglicht, weit über seinen Tellerrand zu schauen, sein
Wissen um die LRS zu vertiefen und sein Handlungsrepertoire zu erweitern. Es macht dabei keine Konzessionen an eine populärwissenschaftliche Darstellung.
Schulratgebertipp:
Ein umfassendes Grundlagenwerk, welches Fachkräften weitreichen de Informationen und praktische Hinweise zur LRS aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglicht.